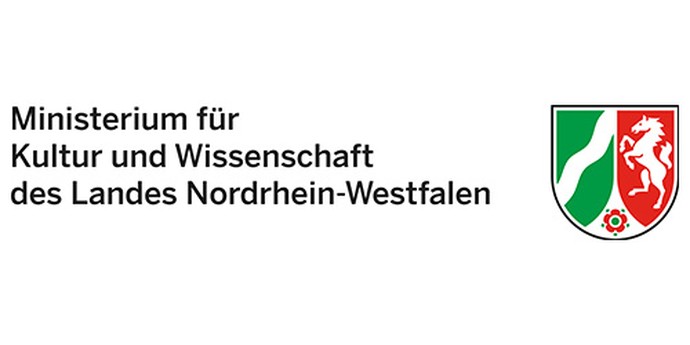KI. Kultur. Nachhaltigkeit.
Von präziser KI-Steuerung der Düngemittel und Bewässerung über intelligente Optimierung in der Abfall- und Kreislaufwirtschaft bis hin zur Effizienzsteigerung der Stromversorgung gibt es vielfältige Szenarien, in denen KI und Nachhaltigkeit positiv korrelieren. Wie das ganz konkret aussehen kann, zeigen unter anderem die Anwendungsbeispiele von Daniel Trauth im ersten Teil des Artikels.
Überträgt man diese Ansätze auf die Arbeit von Kultureinrichtungen, ergeben sich daraus schon auf den ersten Blick unterschiedliche Anwendungsszenarien: KI kann beim nachhaltigen Veranstaltungs- oder Gebäudemanagement unterstützen und beispielsweise durch die Vorhersage von Besucherströmen die Energie- und Ressourcennutzung optimieren. Ressourcenschonend kann sich auch eine smarte Licht- und Klimatechnik auswirken, die gleichzeitig positive und präventive Nebeneffekte auf empfindliche Exponate in Museen haben könnte. Vorrausschauende Wartungsprognosen können helfen, Schließzeiten zu verkürzen und die Kosten und Ressourcen für die Instandhaltung der Kulturbauten reduzieren. Durch die Erstellung digitaler Zwillinge können Ausstellungen und Bühnenbilder vorab geplant und optimiert werden, während in ähnlicher Weise auch beschädigte oder verlorene Kulturgüter digital rekonstruiert werden können. Der Einsatz von generativer KI kann im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit barrierearme Zugänge erleichtern, z.B. durch Gebärdensprach-Avatare, automatisierte Übersetzungen in anderen Sprachen oder die Erstellung virtueller Rundgänge, die weltweite Zugriffe ermöglicht und so weniger Reisezeit verursacht. Auch im Kulturmarketing können Chatbots und Avatare sowie personalisierte Kulturangebote und Analysen von Publikumstrends eine zielgruppenspezifische und nachhaltigere Programmgestaltung erleichtern.
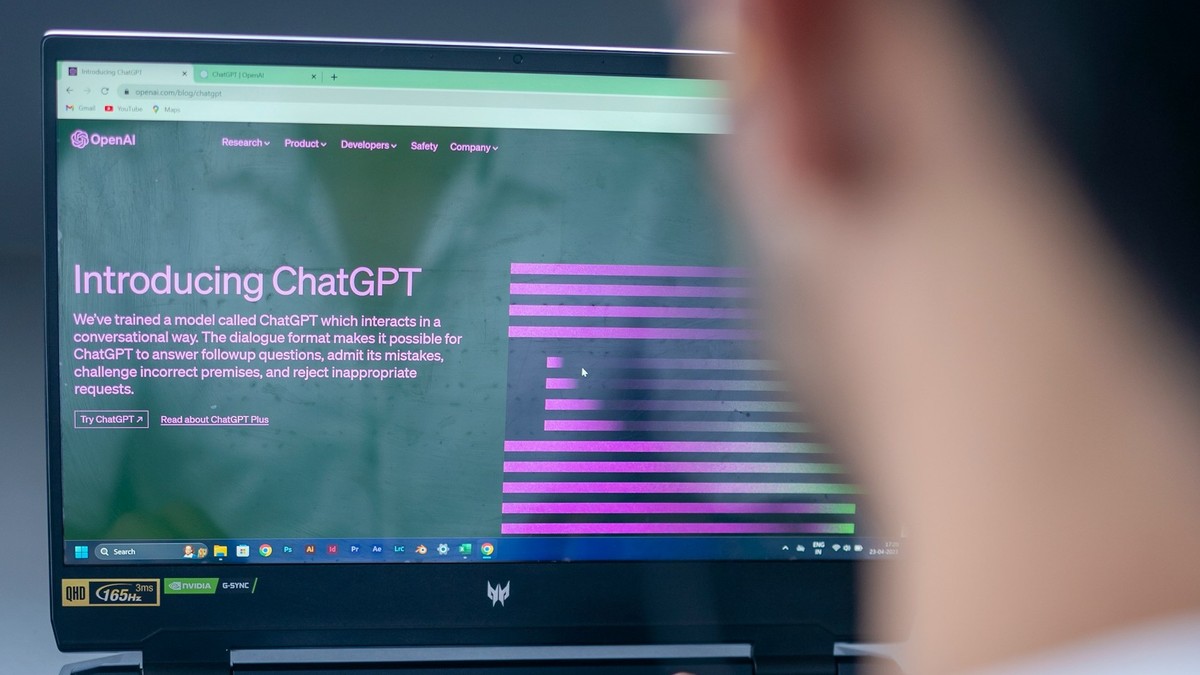
Die Liste der Einsatzmöglichkeiten von KI an der Schnittstelle zu Kultur und Nachhaltigkeit lässt sich mit einem zweiten, geschulten Blick zukünftig sicherlich laufend fortführen und konkretisieren - insbesondere, wenn man auf die konkreten Bedarfe der jeweiligen Kulturorganisationen schaut und die wachsenden technologischen Möglichkeiten in Betracht zieht.* Bereits jetzt wird anhand der genannten Anwendungsbeispiele jedoch deutlich, dass für nachhaltige Zwecke – auch im Kontext von Kultureinrichtungen - vor allem analytische und automatisierende KI-Lösungen relevant sind. Gleichzeitig kann der Umgang mit generativer KI – wie ChatGPT, Gemini und Co. - für Kunst- und Kulturschaffende teilweise einen Mehrwert und eine Unterstützung bei konzeptioneller Arbeit darstellen, wird gerade im Kontext von Kulturarbeit jedoch als große Gefahr betrachtet. Nicht zu vergessen sind dabei natürlich diverse Risiken – wie u.a. Datenschutz, Diskriminierung, Urheberrecht und Wahrheitsgehalt - und natürlich auch die viel diskutierten und kritisierten Auswirkungen auf kreative Schaffensprozesse, künstlerische Qualität und Berufsbilder sowie Existenzen. Vor diesem Hintergrund wurde bereits mehrfach der Schutz von Kunst und Kultur vor KI gefordert und die Notwendigkeit entsprechender einheitlicher Regularien hervorgehoben wie beispielsweise bei der Petition „Schützt die Kunst vor der KI“. [1]
*Eine begriffliche Einordnung und Unterscheidung ist an dieser Stelle und auch im allgemeinen Diskurs unabdingbar. Claude, Gemini und all die weiteren KI-Sprachmodelle, die seit der Veröffentlichung von ChatGPT im Herbst 2022 wie Pilze aus dem Boden sprießen, gehören zu generativer KI. Diese ist nur ein spezieller Teilbereich von Künstlicher Intelligenz, auch wenn der Begriff generative KI fälschlicherweise als deckungsgleich mit KI verwendet wird.

Bedenkt man also einerseits die tiefgreifenden Veränderungen, die Prompting und Co. für Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringen, und andererseits die Belastungen durch Ressourcenverbrauch, Abhängigkeiten und weltpolitische Unsicherheiten, wird deutlich, wie wichtig ethische Leitsätze und klare Rahmenbedingungen für einen verantwortungsvollen Einsatz sind.
Die Europäische KI-Verordnung
Die Europäische Union hat mit der Europäischen KI-Verordnung (European AI Act) im August 2024 weltweit die erste KI-Gesetzgebung erlassen, die KI-Anwendungen nach verschiedenen Risikoklassen einstuft und mit dementsprechend unterschiedlichen Pflichten und Kontrollmechanismen versieht. Gemäß der zugrundeliegenden europäischen Werte, soll die Regulierung die Demokratie und die Bürger:innen schützen und für hohe Transparenz und gute AI Governance sorgen, wird allerdings auch als innovationshemmend und überregulierend kritisiert.* Der AI Act geht nur punktuell auf die umfangreichen Auswirkungen auf die Umwelt ein und sieht größtenteils lediglich freiwillige und unzureichende ökologische Maßnahmen vor. [2] Ein solcher Ansatz, der jedoch ebenfalls auf Eigeninitiative der nutzenden Personen und Organisationen beruht, ist beispielsweise Green Prompting. [3] Die bewusste und idealerweise fehlerfreie Formulierung von Prompts soll dafür sorgen, dass Token und Rechenlast eingespart und damit auch unnötige Energie- und Wasserverbräuche vermieden werden.
*Eine detaillierte Vorstellung der europäischen KI-Verordnung sowie eine Einordnung in den aktuellen Diskurs kann im Rahmen dieses Artikels nicht erfolgen.
Eigenverantwortung im Umgang mit KI
Künstliche Intelligenz kann durchaus ein mächtiger Hebel für Nachhaltigkeit sein – die Entscheidung und Verantwortung für einen nachhaltigen und ethisch vertretbaren Nutzen liegt derweil aber noch bei jedem KI-nutzenden Akteur selbst. Die zugrundeliegende Technologie sollte dabei nicht im Mittelpunkt stehen: Künstliche Intelligenz darf weder für fragwürdige Zwecke noch als Selbstzweck oder bloßes Marketinginstrument genutzt werden – auch wenn sogenanntes AI Washing längst verbreitet ist. Vielmehr sollte Künstliche Intelligenz als ein Tool verstanden werden, welches in einem Werkzeugkasten voller digitaler Technologien eines von vielen Hilfsmitteln sein kann. Bei der Planung und Bewertung von KI-Anwendungen sollte somit immer das (nachhaltige) Ziel im Vordergrund stehen und der Einsatz von KI davon abhängig gemacht werden, welchen tatsächlichen Impact – im positiven wie negativen Sinne - die KI-basierte Lösung schafft und welche Ressourcen und Werte dem zugrunde liegen. In einem solchen Fall wirkt die KI aber eher im Hintergrund, und das widerspricht eindeutig dem derzeitigen Trend. So ist es wenig überraschend, dass ein verantwortungsvoller Umgang im Sinne der Nachhaltigkeit derzeit eher die Ausnahme als die gelebte Praxis darstellt.
Solange der nachhaltige Umgang mit KI nach wie vor eine individuelle Entscheidung bleibt, ist es vor allem eine Haltungsfrage, wie auch Daniel Trauth unterstreicht: „Ich denke, Digitalisierung und Nachhaltigkeit geht super gut zusammen, weil beides eine Haltungsfrage ist. Und wenn sich eine Organisation – egal aus welcher Branche – in beiden Dingen auf den Weg machen will, macht es in meinen Augen einfach Sinn, das zusammen zu machen und nicht voneinander zu entkoppeln“.*
Um das zu ändern und nachhaltige KI stärker im Diskurs und in der Praxis zu verankern, hat das Bundeministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit ein „Fünf-Punkte-Programm Künstliche Intelligenz für Umwelt und Klimaschutz“ ins Leben gerufen und macht sich auf politischer Ebene u.a. für nachhaltige Rechenzentren, optimierte und transparente KI-Modelle und nachhaltige und gemeinwohlorientierte Datenpolitik stark. [4] Darüber hinaus braucht es bei den handelnden Akteuren auch das relevante Wissen, inspirierende und erfolgreiche Beispiele aus der Praxis und eine kritische Reflexionsfähigkeit. Ähnlich wie im Nachhaltigkeitsdiskurs rund um den Handprint, der dem CO2-Footprint gegenübergesetzt wird, kann die Kultur hier eine wesentliche Rolle bei der Sensibilisierung für einen bewussten Umgang mit KI sowie dessen Chancen und Risiken spielen – wie es beispielsweise bereits im Deutschen Museum in Bonn der Fall ist. [5] Dennoch kann und soll die Kultur alleine diese Aufgabe natürlich weder lösen noch gänzlich übernehmen.
„Ich denke, Digitalisierung und Nachhaltigkeit geht super gut zusammen, weil beides eine Haltungsfrage ist.
Und wenn sich eine Organisation – egal aus welcher Branche – in beiden Dingen auf den Weg machen will, macht es in meinen Augen einfach Sinn, das zusammen zu machen und nicht voneinander zu entkoppeln“.*
Um das zu ändern und nachhaltige KI stärker im Diskurs und in der Praxis zu verankern, hat das Bundeministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit ein „Fünf-Punkte-Programm Künstliche Intelligenz für Umwelt und Klimaschutz“ ins Leben gerufen und macht sich auf politischer Ebene u.a. für nachhaltige Rechenzentren, optimierte und transparente KI-Modelle und nachhaltige und gemeinwohlorientierte Datenpolitik stark. [4] Darüber hinaus braucht es bei den handelnden Akteuren auch das relevante Wissen, inspirierende und erfolgreiche Beispiele aus der Praxis und eine kritische Reflexionsfähigkeit. Ähnlich wie im Nachhaltigkeitsdiskurs rund um den Handprint, der dem CO2-Footprint gegenübergesetzt wird, kann die Kultur hier eine wesentliche Rolle bei der Sensibilisierung für einen bewussten Umgang mit KI sowie dessen Chancen und Risiken spielen – wie es beispielsweise bereits im Deutschen Museum in Bonn der Fall ist. [5] Dennoch kann und soll die Kultur alleine diese Aufgabe natürlich weder lösen noch gänzlich übernehmen.
*So äußerte sich Dr. Daniel Trauth im Zuge des Interviews für den Artikel „Kann Künstliche Intelligenz auch grün?“
Das AI Village in Hürth
Das AI Village in Hürth greift genau diese anfänglichen Hürden und Zweifel auf und unterstützt Unternehmen sowie Organisationen im Rheinischen Revier dabei, sich Schritt für Schritt mit KI und Robotik vertraut zu machen. Beheimatet im Studio 6 in Hürth, wo einst Hans Meiser seine TV-Produktionen drehte, bietet das AI Village viel Raum zum Austausch und Vernetzen und bildet das Zentrum für ein wachsendes KI-Ökosystem im Rheinland. Mit einem vielfältigen und kostenfreien Angebot an Veranstaltungen, Weiterbildungen und individuellen Use-Case-Workshops sollen insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen der Region sensibilisiert und befähigt werden, Zukunftstechnologien wie KI, Robotik oder Blockchain sowie deren Potentiale zu verstehen und im besten Fall in ihren Unternehmen einzuführen und anzuwenden.
Ein niedrigschwelliger und spielerischer Ansatz steht dabei im Mittelpunkt, der Expert:innen sowie KI-Neulinge gleichermaßen zusammenbringt, Berührungsängste abbaut und KI im ersten Schritt erlebbar macht. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, kann mit dem Team des AI Village weitere Schritte zur Vertiefung definieren und konkrete unternehmensspezifische Lösungswege erarbeiten und erhält in Anlehnung daran verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten aus dem gesamten Partnernetzwerk. Im Kern ist das AI Village in Konsortium der Stadt Hürth, des KI Bundesverbands, der Rheinischen Hochschule, des Fraunhofer Fit, des Fraunhofer IAIS sowie von KI.NRW. Darüber hinaus ist es eng mit weiteren Institutionen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen an der Schnittstelle zu KI verknüpft. Das gemeinsame Ziel, die Region zukunftsfähig zu machen, fußt auf dem einstigen Beschluss der Bundesregierung zum Braunkohleausstieg, der für das Rheinische Revier mit großen Transformationsprozessen einhergeht. Diesen Strukturwandel aktiv mitzugestalten und die Region mittels KI-Expertise zu unterstützen, hat sich das AI Village seit März 2023 zur Aufgabe gemacht und wird dafür vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
Einen Überblick aller Angebot sowie weitere Informationen über das AI Village sind unter www.aivillage.de verfügbar.
Literaturverzeichnis
[1] Vgl.: Schützt die Kunst vor der KI. https://www.openpetition.de/petition/online/schuetzt-die-kunst-vor-ki-deinestimmefuerechtestimmen (25.08.2025)
[2] Vgl.: Öko-Institut e.V.: The European Parliament’s amendments to the AI Act. 2023.
[3] Vgl.: Adamska et. al: Green Prompting. 2025. https://arxiv.org/html/2503.10666v1 (17.09.2025)
[4] Weitere Informationen zur Initiative und KI-Ideenwerkstatt für Umweltschutz unter https://www.ki-ideenwerkstatt.de/ki-umweltschutz/ (17.09.2025)
[5] Weitere Informationen zum Angebot des Deutsches Museum Bonn unter: https://www.deutsches-museum.de/bonn (17.09.2025)
Kurzvita der Autor:innen
Marje Brütt
Als KI-Projektmanagerin im AI Village in Hürth unterstützt Marje Brütt Akteur:innen im Rheinischen Revier beim Praxistransfer und Kompetenzaufbau rund um KI. Nach Tätigkeiten als Digitalisierungsreferentin für KI im LVR und freiberufliche Transformationsmanagerin für nachhaltige Kultur setzt sich dafür ein, KI und Nachhaltigkeit möglichst zusammenzudenken und ganzheitlich und menschenzentriert einzusetzen.
Dr. Daniel Trauth
Als mehrfacher Unternehmer, Dozent für Digital Business und Vorstandsmitglied beim IDiTech engagiert sich Dr. Daniel Trauth für eine bessere und nachhaltigere Zukunft durch digitale Transformation ein. Mittels Blockchain, KI und IoT und Co. findet er innovative und grüne Lösungen und Geschäftsmodelle und berät und begleitet Unternehmen auf dem Weg dorthin.
Das könnte Sie auch interessieren:
Nachhaltigkeit im Kleinen - Raus ins Land
Das NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste (LFDK) bringt mit seinem Programm "Raus ins Land" Theater in ländliche Räume und erfüllt gleichzeitig das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit. Ein Bericht von Carina Graf.

Von Kennzahlen und Wesentlichkeit
Wie misst man Nachhaltigkeit in der Kultur? In diesem Blogbeitrag zeigt Jenia Kohlmetz, warum Zahlen allein hierfür nicht genügen – und wie Museen, Theater und andere Kulturinstitutionen ihre Wirkung jenseits von CO₂-Bilanzen sichtbar machen können.

Kann Künstliche Intelligenz auch grün? (Teil 1)
Künstliche Intelligenz - Nachhaltigkeitstreiber oder Ressourcenfresser? Im ersten Teil unseres KI-Blogbeitrags sprechen Marje Brütt und Dr. Daniel Trauth im Interview über Projekte, die KI gezielt für nachhaltige Zwecke verwenden.

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Newsletter
Mit unserem Newsletter erhalten Sie monatlich Aktuelles rund um das Thema Energie und Nachhaltigkeit.
Wie bewegt Nachhaltigkeit die Kultur in Nordrhein-Westfalen? Folgen Sie uns auf LinkedIn und bringen Sie sich ein.