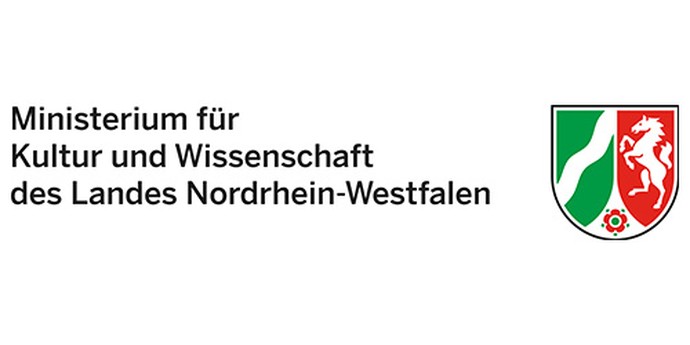Künstliche Intelligenz - Lösung oder Teil des Problems?
Die Schattenseiten von KI sind schwer zu übersehen: Für das Training großer Sprachmodelle werden Rechenzentren betrieben, die immense Energiemengen benötigen. Allein ein einzelnes KI-Modell kann so viel Strom verbrauchen wie mehrere tausend Privathaushalte im Jahr. Laut Umweltbundesamt haben Rechenzentren in Deutschland bereits 2020 circa drei Prozent des deutschen Stroms verbraucht [1]. Hinzu kommt der Ressourcenbedarf für Hardware – von seltenen Erden für Prozessoren bis hin zu Lieferketten, die häufig mit ökologischen und sozialen Problemen wie Umweltzerstörung oder schlechten Arbeitsbedingungen verbunden sind. Auch der steigende Wasserverbrauch in Kühlanlagen von Serverfarmen wirft Fragen nach regionalen und globalen Auswirkungen auf und lässt KI eher wie einen Treiber von Emissionen, Energiebedarfen und sozialer Ungerechtigkeit dastehen.
Gleichzeitig eröffnet KI aber auch neue Möglichkeiten für nachhaltiges Handeln und bietet kleine wie großflächige Lösungsansätze. In der Energiewirtschaft werden KI-gestützte Systeme eingesetzt, um Stromnetze flexibler und effizienter zu steuern, sodass erneuerbare Energien besser integriert werden können. In der Landwirtschaft helfen Algorithmen dabei, Dünger und Wasser präziser einzusetzen und so Ressourcen zu schonen. Städte nutzen KI, um Verkehrsflüsse zu optimieren und Emissionen zu reduzieren. Auch in der Kreislaufwirtschaft spielt KI eine Rolle – etwa wenn intelligente Sortieranlagen Abfälle effizienter trennen und so das Recycling verbessern.
Ist KI also eher Lösung oder Teil des Problems? Zwischen diesen Polen bewegt sich die aktuelle Debatte an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und KI. Die Antwort liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen und hängt maßgeblich davon ab, wie wir diese Technologie nutzen und welche politischen, wirtschaftlichen und ethischen Leitplanken dem zugrunde gelegt werden.
(Der Artikel beinhaltet keine vertiefende, kritische Auseinandersetzung mit den Sonnen- und Schattenseiten von KI für Nachhaltigkeit, sondern konzentriert sich in diesem Rahmen auf praktische Einblicke in die Nutzung von KI für nachhaltige Zwecke.)
Daniel Trauth im Interview mit Marje Brütt
Einige konkrete Beispiele, die KI für nachhaltige Zwecke verwenden, hat Dr. Daniel Trauth mit dem IDiTech e.V. – Institut für digitale Zukunftstechnologien – bereits in die Praxis umgesetzt und teilt daraus im Folgenden wertvolle Einblicke und Erfahrungswerte im Interview.
Marje Brütt: Welche konkreten Use Cases und Projekte hast du umgesetzt, bei denen Nachhaltigkeit im Zentrum steht und welche Rolle hat KI dabei gespielt?
Daniel Trauth:
Bei Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne fällt mir die Open Sustainability App [3] ein – ein Pilotprojekt das wir als IDiTech gemeinsam mit Rewe gestartet haben. Im Kern ging es darum, den CO2-Footprint eines Einkaufs zu berechnen und das möglichst einfach und nutzendenorientiert. Denn wie gut oder schlecht oder wie teuer oder günstig ein Produkt ist, wissen die Kunden in der Regel. Wir wollten ihnen auch ein Gefühl dafür geben, wie teuer es im Sinne des CO2-Abdrucks als eine andere Art der Währung ist.
Nach deinem Einkauf machst du mit deinem Smartphone ein Foto deines Kassenzettels – das kann mittlerweile im Grunde fast jeder. Die generative KI hilft dann dabei, die Artikel korrekt zuzuordnen, denn auf dem Kassenbon steht ja kein Fließtext, sondern je nach Anbieter ein unterschiedlicher Name für das eigentlich selbe Produkt. Das was zum Beispiel in einem Rewe der Snickers ist, ist in einem Lidl oder Penny anders benannt. Die generative KI erkennt zum einen, dass sich bei all diesen Produkten um Schokoriegel handelt und ist selbstständig in der Lage die Eckdaten des Produktes in verifizierten Datenbanken nachzuschauen und daraus den CO2-Fußabdruck zu berechnen. Den Kund:innen wird es damit also sehr leicht gemacht: sie machen ein Foto und erhalten als Ergebnis eine Art Kontostand für ihre CO2-Bilanz. Wenn wir das ausweiten könnten auf Bäckereien, Tankstellen, Drogerien etc. wäre es möglich, mehr Transparenz über unser Konsumverhalten und dessen Nachhaltigkeit zu gewinnen. Neben KI spielt dabei auch die Blockchain eine wichtige Rolle, um die Transaktionen und Integrität dahinter zu sichern.
Marje Brütt:
Eingangs hast du erwähnt, dass du mit deinen Projekten bereits verschiedene Nachhaltigkeitsdimensionen berührt hast. Kannst du ein weiteres Beispiel vorstellen?
Daniel Trauth:
Smart Waste in Hürth ist ein weiteres Projekt, mit dem wir soziale wie ökologische und letztendlich auch ökonomische Aspekte adressieren und anhand von intelligenten Mülleimern Wildmüll in der Stadt vermeiden und eine tagesaktuelle Routenplanung der Stadtwerke ermöglichen. Ursprünglich entstand das Projekt auf einen Impuls von Bürgermeister Dirk Breuer, der auf uns zugekommen ist, um Lösungen für die Reduzierung von Wildmüll zu finden. Daraus sind dann wie bei einem Schmetterlingseffekt zahlreiche andere nachhaltige Ergebnisse erstanden und das waren auch für uns sehr wertvolle Erkenntnisse.

Ein positiver Aspekt wird anhand der CO2-Einsparungen deutlich, die durch die optimierte Routenführung der Stadtwerke ermöglicht wird. Normalerweise können sie die Menge an (Wild)Müll nicht antizipieren und müssen ggf. mehrfach fahren, weil die verfügbare Ladefläche nicht für die Mengen an Müll ausreicht. Daraus folgen Mehrfahrten sowie teilweise erhöhte Benzin- und Personalkosten, Zeitverlust und unter Umständen auch, dass die restliche Route nicht mehr geleert werden kann, was an der verbleibenden Strecke wiederum zu überfüllten Mülleimern und erhöhtem Wildmüll führen kann. Problematisch ist dabei auch, dass die Menschen mittlerweile von Autoreifen über Küchenschränke bis hin zu Spraydosen und Benzinkanistern alles Mögliche dort entsorgen und so eine auslaufende Spraydose ebenfalls negative ökologische Folgen hat. Genau berechnen lassen sich diese Nachhaltigkeitsaspekte in Form von CO2-Einsparungen natürlich nicht immer, aber die Folgen sind tatsächlich spürbar. Je eher dem Wildmüll also vorgebeugt wird oder je früher er abgeholt wird, desto leichter lassen sich solche Folgeschäden vermeiden.
Auch aus sozialer Sicht hat das Smart Waste Projekt positive Nebeneffekte. Die Routen- und Personalplanung der Stadtwerke wird durch die intelligenten Mülleimer immens erleichtert und effizienter gestaltet. Denn die Mitarbeitenden bekommen in Anlehnung an die Füllstände der städtischen Mülleimer eine tagesaktuelle Routenplanung per App zugestellt. Diese ist direkt mit Google Maps verknüpft und macht die Route im Sinne der Barrierefreiheit in zahlreichen Sprachen für die Mitarbeitenden zugänglich.

Dass das Projekt aber überhaupt erst möglich wurde, ist nochmal eine ganz andere Form der Nachhaltigkeit. In Hürth gibt es ein IoT-Funknetzwerk*, das von den Bürger:innen betrieben wird. Anstatt auf den Aufbau eines eigenen IoT-Netzes durch die Stadtwerke zu setzen – was üblicherweise in anderen Städten der Fall ist und zusätzliche Zeit und Ressourcen erfordert – haben wir für dieses Pilotprojekt mit den Bürger:innen zusammengearbeitet und sie aktiv in die Lösung der Wildmüll-Problematik eingebunden. An einigen Stellen haben die Stadtwerke das Funknetz der Bürger:innen etwas ausgebaut und unterstützt und es so für beide Seiten langfristig verbessert und nutzbar gemacht. Mit Blick auf das Smart Waste Projekt werden über dieses IoT-Netz die Sensordaten zu den Füllständen der Mülleimer übermittelt, die die Grundlage für das gesamte Projekt darstellen. Die Realität ist einfach ein Hybrid: ohne Blockchain wird es dieses Netzwerk nicht geben, ohne dieses Netzwerk wird es diese KI nicht geben und ohne diese KI wird es keine saubere Stadt Hürth geben.
* IoT = Internet of Things: Vernetzung von physischen Geräten und Objekten über das Internet, sodass diese Daten austauschen und selbstständig miteinander kommunizieren können [2].
Literaturverzeichnis
[1] Umweltbundesamt (10. Januar 2022). Rechenzentren. Abgerufen von Rechenzentren | Umweltbundesamt (Stand: 22.09.2025).
[2] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (o. J.). Internet der Dinge. Abgerufen von BSI - Internet der Dinge - Smart leben (Stand: 22.09.2025).
[3] Open Sustainability App Beta (o. J.). Open Sustainability App [Dashboard]. Abgerufen von OpenSustainabilityApp (Stand: 22.09.2025).
Kurzvita der Autor:innen
Marje Brütt
Als KI-Projektmanagerin im AI Village in Hürth unterstützt Marje Brütt Akteur:innen im Rheinischen Revier beim Praxistransfer und Kompetenzaufbau rund um KI. Nach Tätigkeiten als Digitalisierungsreferentin für KI im LVR und freiberufliche Transformationsmanagerin für nachhaltige Kultur setzt sich dafür ein, KI und Nachhaltigkeit möglichst zusammenzudenken und ganzheitlich und menschenzentriert einzusetzen.
Dr. Daniel Trauth
Als mehrfacher Unternehmer, Dozent für Digital Business und Vorstandsmitglied beim IDiTech engagiert sich Dr. Daniel Trauth für eine bessere und nachhaltigere Zukunft durch digitale Transformation ein. Mittels Blockchain, KI und IoT und Co. findet er innovative und grüne Lösungen und Geschäftsmodelle und berät und begleitet Unternehmen auf dem Weg dorthin.
Direkt weiterlesen:
Intelligente Kultur: Wie KI unterstützen kann (Teil 2)
Im zweiten Teil unseres Blogbeitrags zu KI geht es um konkrete Einsatzmöglichkeiten von KI in der Kultur.

Reparieren statt Wegwerfen: Hilft das Handwerk bei der Nachhaltigkeit?
Wie wurde das Handwerk zum Reparaturhandwerk – und warum gab es irgendwann kaum noch etwas zu reparieren? Das LWL-Freilichtmuseum Hagen nimmt Sie mit auf eine Zeitreise durch das Handwerk des 20. Jahrhunderts.

Drei gewinnt: Nachhaltigkeit ganzheitlich denken in der Kultur
Was bedeutet ganzheitliche Nachhaltigkeit in der Kultur? Daniel Seitz erklärt, worauf es ankommt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Newsletter
Mit unserem Newsletter erhalten Sie monatlich Aktuelles rund um das Thema Energie und Nachhaltigkeit.
Wie bewegt Nachhaltigkeit die Kultur in Nordrhein-Westfalen? Folgen Sie uns auf LinkedIn und bringen Sie sich ein.