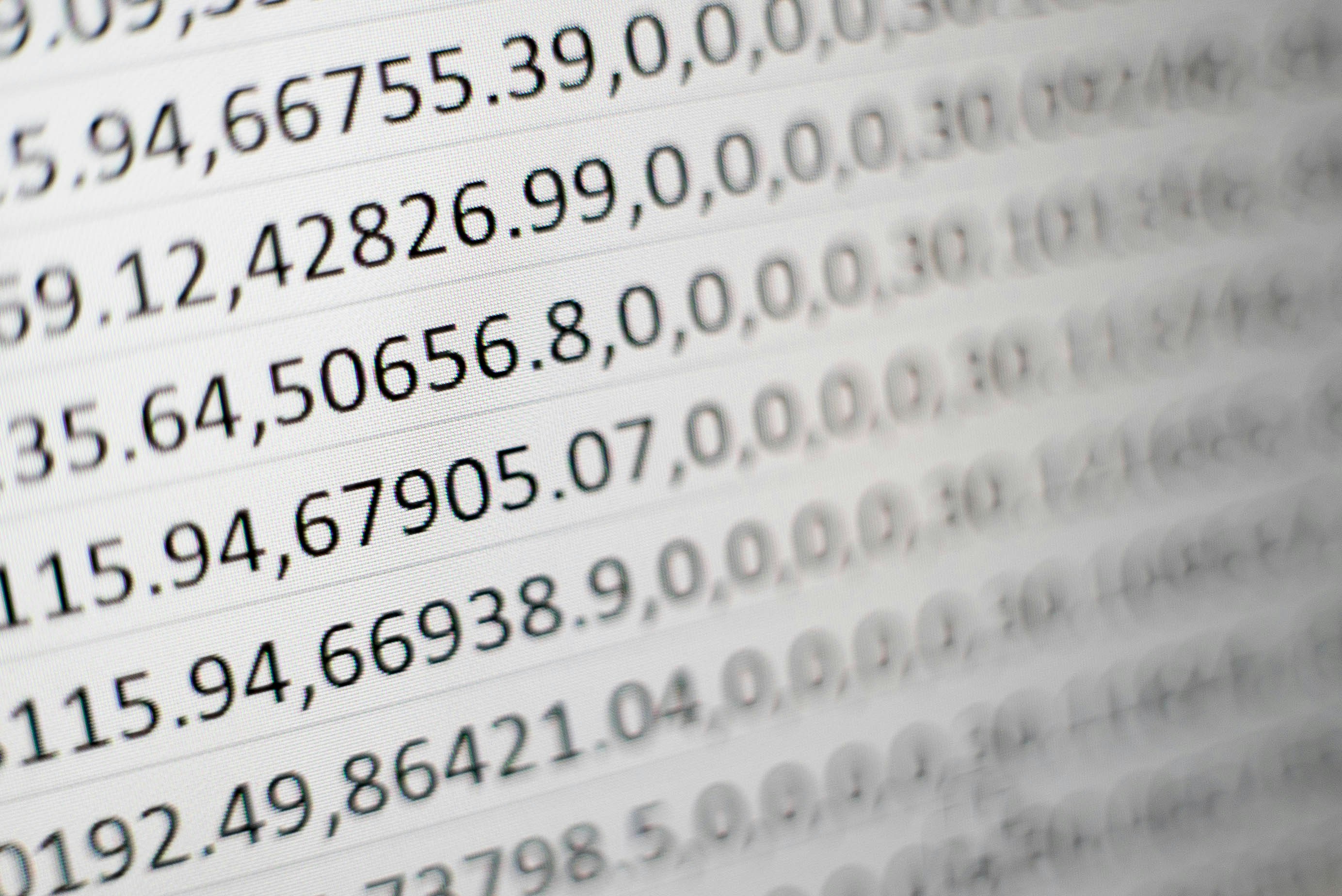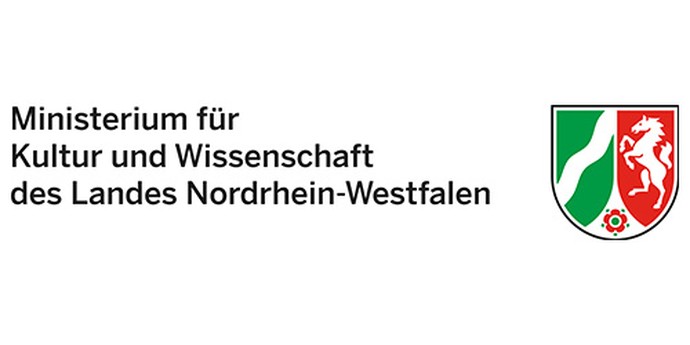Das richtige System finden
Kultur kann als Antrieb für nachhaltigen Wandel und Innovation fungieren, denn ihre Fähigkeit, Menschen zu erreichen und zu inspirieren, macht sie zu einer entscheidenden Akteurin im globalen Bestreben nach einer nachhaltigen Zukunft. Doch wie gehen wir das Ganze an? Wir brauchen Struktur!
Nachhaltigkeitsberichterstattung wie der Deutsche Nachhaltigkeitskodex oder Zertifizierungen wie EMAS, ISO 20121, Gemeinwohlbilanz oder Ökoprofit können es Institutionen ermöglichen, systematisch ihre Verbräuche zu analysieren und Maßnahmen strukturiert und nachhaltig in Aktionsplänen zu implementieren. Eine erstmalige Erstellung eines solchen Systems bedeutet nicht nur eine Menge Arbeit, auch muss dieses System nach der Einführung mit Leben gefüllt werden. Das Leben eines solchen Systems benötigt Planungssicherheit und diese stellt insbesondere die Kultur vor große Herausforderungen, weil sie abhängig von Förderstrukturen ist und häufig projektbezogen arbeitet.
Dabei sind die Berichterstattung und ein Umwelt-Managementsystem mehr als nur eine formale Anforderung, sie bieten auch die Möglichkeit zur Reflexion und Weiterentwicklung der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie. [1] Zertifizierungen und Berichterstattung schaffen Transparenz und Nachvollziehbarkeit, sodass Maßnahmen auf Fakten statt auf Bauchgefühl beruhen. Sie fördern eine fortlaufende Verbesserung, weil Prozesse messbar und gezielt optimierbar werden.
Die Einführung eines neuen Systems erfordert jedoch Ressourcen und Engagement. Zugleich bergen Herausforderungen immer auch Potenziale und die Kultur konnte in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis stellen, dass sie durch ihr Wesen imstande ist, dynamisch und kreativ auf Herausforderungen zu reagieren. Mit ihrer innovativen Betrachtung kann sie neue Wege zu umweltfreundlichen und sozial gerechten Praktiken aufzeigen. [2] Es gilt außerdem, die gewählte Zertifizierung oder den Berichtsstandard an die Kultur anzupassen. Das erfordert viel Transferleistung, ein Gespür für die Wesentlichkeit der Organisation sowie ein gutes Verständnis der jeweiligen Methode.
Die Frage der Kennzahlen
Anstatt Sie mit den vielen trockenen mitgeltenden Dokumenten zu langweilen, möchte ich gerne auf die Problematik der Vergleichbarkeit und die Frage der Kennzahlen zu sprechen kommen, weil diese mir besonders am Herzen liegen. Kennzahlen sind messbare Größen, mit denen sich Prozesse und Entwicklungen gezielt beobachten lassen können. Dabei geht es nicht nur um absolute Werte (z.B. Strom- oder Wärmeverbrauch), sondern um deren Verhältnis – etwa Liter fossilen Brennstoffs pro Kilometer als bekanntes Beispiel aus der Mobilität. So machen Kennzahlen komplexe Sachverhalte sichtbar und vergleichbar, etwa wenn es darum geht, wie effizient Ressourcen eingesetzt oder Ziele erreicht werden.
Die wesentlichen Zahlen: Key Performance Indicators
Kulturelle Produktionen und Institutionen zeichnen sich durch Vielfalt und manchmal projektbasierte Prozesse aus. Daher müssen insbesondere Kennzahlen – wie die sogenannten Key Performance Indicators (KPI) – mit besonderer Vorsicht formuliert werden. Eignet es sich, für meine Institution kWh pro Mitarbeitenden aufzuführen, wenn meine Institution durch die Freischaffenden lebt? Ist kWh pro Fläche die richtige Bezugsgröße, wenn die Fläche nicht relevant für den Verbrauch ist? Ist kWh pro Besuchende der Indikator, mit dem ich ins Spiel gehen möchte?
Pluralität und Mannigfaltigkeit kultureller Institutionen sind wesentliche Stärken der Kultur. KPIs und Kennzahlen, die sektoren- und branchenübergreifend in anderen Wirtschaftszweigen für eine Vergleichbarkeit sorgen, müssen für die Kulturbranche neu gedacht, definiert oder gänzlich hinterfragt werden. Es muss ein zentrales Ziel bleiben Missverständnisse aufzudecken, die zu einer verzerrten Vergleichbarkeit führen.
Kennzahlen vermitteln den Eindruck einer zusammenfassenden Essenz in der externen Kommunikation. Die Diversität in der Kulturbranche macht eine direkte Vergleichbarkeit aber schwierig. Nicht nur die Architektur und die Gebäudehüllen, in denen unsere Kunst und Kultur stattfindet, sind vielfältig, sondern auch die Wesentlichkeit und die Programmatik jeder einzelnen Institution ist sehr unterschiedlich und zeitgleich in sich selbst divers. Würde in der Kulturindustrie nach Wert und Wirtschaftlichkeit beurteilt werden, wären wir in einer kulturpolitischen Grundsatzdiskussion und mit der Frage beschäftigt, was in Zukunft förderfähig sei. [3]
Wie können die Kennzahlen eine Vergleichbarkeit suggerieren, wenn die Stärke unserer Kulturlandschaft die Vielfalt ist?
Durch eine Vergleichbarkeit kann so Druck entstehen, und es wirft die Frage auf, ob dieser Druck notwendig für eine nachhaltige Entwicklung ist.
Finde die Big Points
Eine reine CO₂-Bilanz misst Emissionen und sie ist wichtig für einen Überblick und einen Status quo. Aber sie bleibt blind gegenüber dem gesellschaftlichen Impact der Kultur. Entscheidend ist deshalb, Strukturen zu schaffen, mit denen sich Wirkung überhaupt erfassen und verstehen lässt. Statt nur über Nachhaltigkeit zu reden oder sie mit Messwerten zu zeigen, braucht es ein funktionierendes System, das Daten, Erfahrungen und Erkenntnisse miteinander verbindet.
Es geht darum, die richtigen Kennzahlen zu finden – jene, die wirklich etwas über die Wirksamkeit einer Organisation aussagen. Nicht jede Zahl ist relevant, und nicht alles, was messbar ist, ist wesentlich. Die Herausforderung besteht darin, aus der Vielfalt kultureller Aktivitäten die Big Points zu identifizieren: Wo entstehen Wirkung, Energieverbrauch, gesellschaftlicher Mehrwert oder Lernprozesse tatsächlich?
Vom Projekt zur Praxis: Wissenssicherung und -transfer
Ein solches System lebt von Wissenssicherung und -transfer. Wenn Institutionen ihre Erfahrungen dokumentieren, voneinander lernen und komplexe Zusammenhänge in klare Strukturen übersetzen, entsteht langfristige Handlungsfähigkeit. So wird Nachhaltigkeit vom Projekt zur Praxis – nachvollziehbar, überprüfbar und anschlussfähig. Zahlreiche Initiativen zeigen bereits, dass die Branche aktiv wird: Reiserichtlinien, Green Riders, Leitfäden, Netzwerktreffen und Weiterbildungen sind Zeichen eines spürbaren Bewusstseinswandels. Doch vieles geschieht heute noch ehrenamtlich oder als „on top“-Aufgabe innerhalb bestehender Teams – eine Belastung, die langfristig nicht nachhaltig ist.
Erkenntnisse gewinnen und Maßnahmen ergreifen
Letztlich liegt der Nutzen in der Umsetzung: CO₂-Bilanzen und ihre KPIs sind Ausgangspunkt, nicht Ziel. Die Frage bleibt, welche konkreten Maßnahmen aus den Erkenntnissen folgen — von klimafreundlicher Logistik über energieeffiziente Gebäudemanagementsysteme bis hin zu inklusiven Vermittlungsformaten, die soziale Gerechtigkeit und Diversität fördern. Die Kultur kann durch kreative Ansätze, Kooperationen und partizipative Formate maßgeblich zur gesellschaftlichen Transformation beitragen.
Kultur als Katalysator für nachhaltigen Wandel
Die Kulturbranche steht damit nicht nur in der Verantwortung, Emissionen zu reduzieren, sondern auch darin, Handlungsräume zu öffnen und die Gesellschaft für nachhaltige Lebensweisen zu begeistern. Sie ist Katalysator und Motor zugleich: Mit der richtigen Förderung, klaren Strukturen und offenem Dialog kann Kultur zeigen, wie Nachhaltigkeit sowohl praktisch umgesetzt als auch kulturell verankert werden kann. Es bleibt eine gemeinschaftliche Aufgabe – die Kultur hat das Potenzial, beispielhaft voranzugehen und andere Sektoren zu inspirieren. Jetzt geht es darum, diesen Weg mit Mut, Ressourcen und Verantwortungsbewusstsein konsequent weiterzugehen.
Literaturverzeichnis
[1] Vgl. McGhie, Henry (Hrsg.) (2023): Museums for Better Futures. Taking action for sustainable development. Churchill Fellowship Report, Liverpool, Liverpool, S.12-13. Abgerufen von http:// www.curatingtomorrow.co.uk/wp-content/uploads/2023/11/museums-for-better-futures_2023.pdf (Stand 20.10.25)
[2] Vgl. Buro Happold / Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (Hrsg.) (2022): Theater Green Book. Praxis-Handbuch für nachhaltiges Arbeiten im und am Theater, Köln, S.16. Abgerufen von https:// greenbook.dthgev.de/theatre-green-book/ (Stand 20.10.25)
[3] Vgl. Affolter, Saskia (2024): Wahlerfolg der AfD. Das befürchten Kulturschaffende, Abgerufen von https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/afd-einfluss-kulturpolitik-kommunalwahl-mitteldeutschland-kultur-news-100.html (Stand 20.10.25)
[4] Vgl. Stoltenberg, Ute (2020): Kultur als Dimension eines Bildungskonzepts für eine nachhaltige Entwicklung, in: Kulturelle Bildung Online, o.S.. Abgerufen von https://www.kubi-online.de/artikel/ kultur-dimension-eines-bildungskonzepts-nachhaltige-entwicklung (Stand 20.10.25)
[5] „Das Aufbrechen alter Denkmuster, der gewachsenen mentalen Infrastrukturen […] ist das Kerngeschäft von Kunst und Kultur. Hier eröffnet sich ein Raum der Möglichkeiten, in dem das ganz Andere, das Unerwartete auftauchen kann, in dem auch das Ungewisse Platz hat und Optionen imaginiert und durchgespielt werden können.“ Leipprand, Eva (2013): Kultur, Bildung und Nachhaltige Entwicklung, in: Kulturelle Bildung Online, o.S.. Abgerufen von https://www.kubi-online.de/ artikel/kultur-bildung-nachhaltige-entwicklung (Stand 20.10.25)
[6] Vgl. Kulturpolitische Gesellschaft e.V. / Culture4Climate (Hrsg.) (2023): Next Practice. Beispiele für klimaverantwortliches Handeln in Kulturorganisationen, Bonn, S.5-7. Abgerufen von https:// culture4climate.de/wp-content/uploads/2023/11/Culture4Climate_NextPractice.pdf (Stand 20.10.25)
[7] Vgl. Kulturstiftung des Bundes / Haus der Kulturen der Welt / Öko-Institut e.V. / (Hrsg.) Müller, Janek / Wegner, Agnes (2011): Über Lebenskunst. Nachhaltig produzieren im Kulturbereich, Berlin, S.2. Abgerufen von http://www.ueber-lebenskunst.org/downloads/uelk_leitfaden_01_de.pdf (Stand 20.10.25)
Kurzvita der Autorin
Jenia Kohlmetz
Nach 8 Jahren Museumsarbeit als Kuratorin und in der Kunstvermittlung studierte Jenia Kohlmetz Angewandte Nachhaltigkeit. In ihrer Masterarbeit setzte sie sich mit der Wesentlichkeits- analyse und CO₂-Bilanzierung in der Kultur auseinander. Als Umwelt- managementbeauftragte bei PACT Zollverein führte sie EMAS ein und arbeitet heute als Energieberaterin.