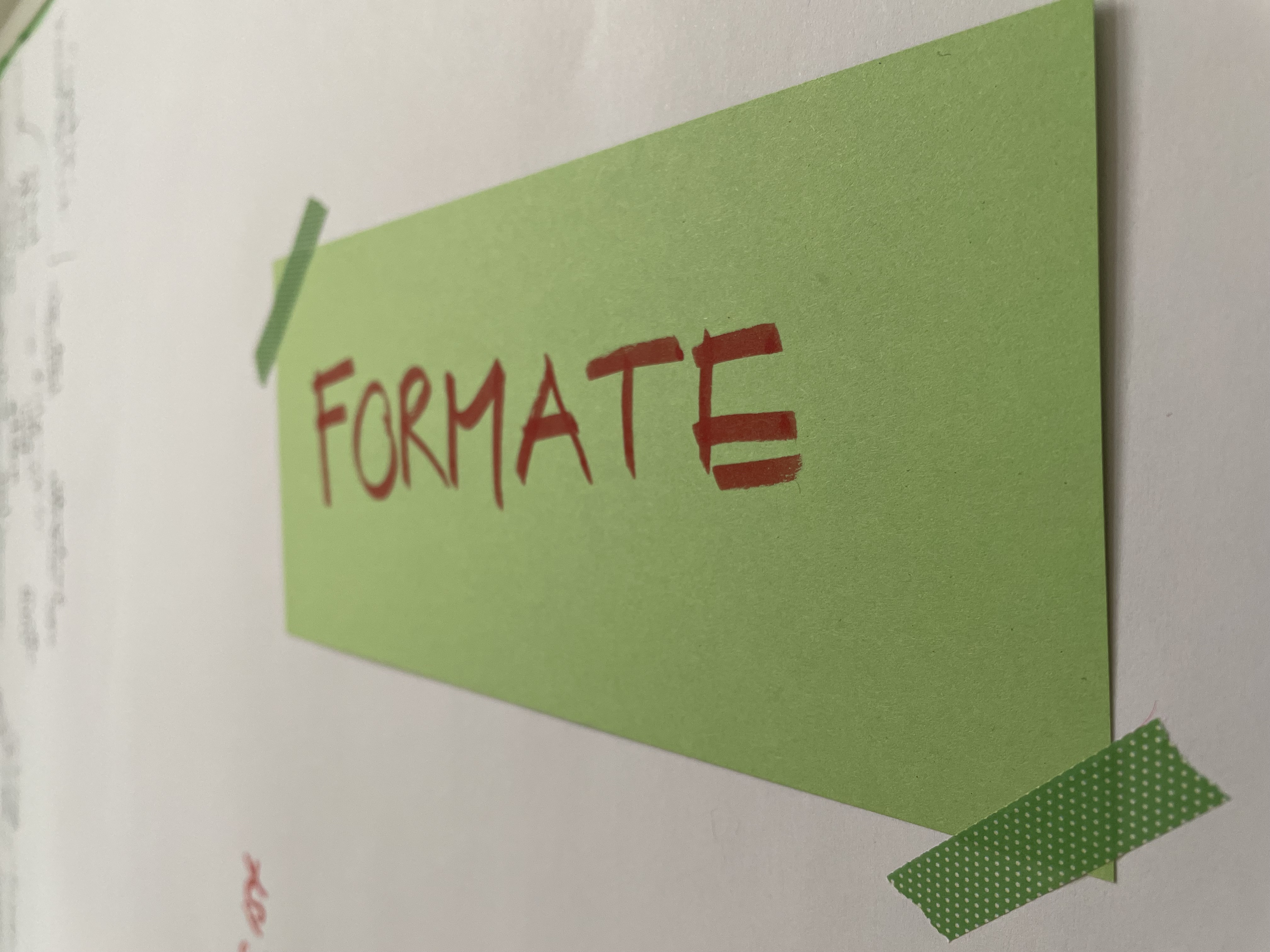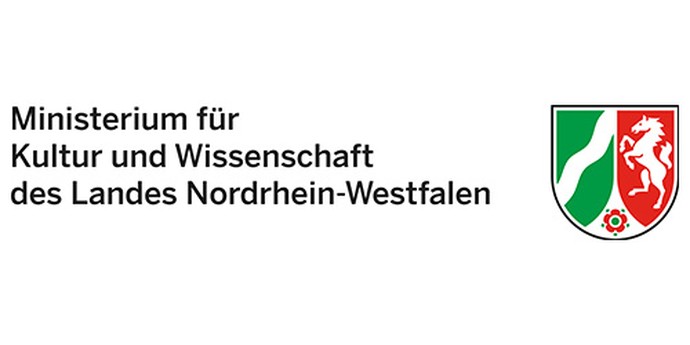Studio Audience will das gängige Verständnis von Publikum hinterfragen. Was bedeutet das konkret, und warum ist das wichtig für eine nachhaltige Kulturarbeit?
Anna Döbbelin:
Das Studio Audience versteht sich als Interessenvertretung für Menschen, die sich nicht im Programmangebot der Kulturlandschaft repräsentiert fühlen. Wir beobachten, und können dies auch anhand von Studien belegen, dass das sogenannte klassische Kulturpublikum eigentlich immer das gleiche ist. Das bestätigen auch die Kulturmacher:innen aus ihrer Praxis. Im Sinne der kulturellen Teilhabe wünschen sich zwar alle eine Hinwendung zu mehr Diversität, bislang fehlt es aber an erfolgreichen Strategien, um diese zu erreichen.
Das Studio Audience wurde im März 2023 gegründet, um als Mittler zwischen Publikum und Kulturarbeiter:innen bei diesem Prozess zu unterstützen, zu beraten und immer wieder selbst auszuprobieren. Dazu gehört, Strukturen zu hinterfragen und Publikum zu befragen.
Jérôme Jussef Lenzen:
Uns ist bei dieser Arbeit wichtig, dass es beim Audience Development nicht um ein nice-to-have geht, sondern ganz zentral um die Frage, wie wir unser Kulturangebot in Gegenwart und Zukunft relevant machen. Insbesondere die gegenwärtigen Diskussionen um Kürzungen an den Kulturhaushalten haben gezeigt, dass wir gute Argumente brauchen, um auch in Zukunft noch unsere Arbeit machen zu können.
Wie sieht die praktische Arbeit von Studio Audience aus – welche Methoden oder Formate nutzt ihr, um Kulturinstitutionen für mehr Teilhabe zu sensibilisieren und zu öffnen?
Anna Döbbelin:
Zunächst stand der Aufbau einer Organisationstruktur mit einem auf die Bedarfe der Szene zugeschnittenem Leistungsangebot auf unserer Agenda. Dazu gehört auch die intensive Recherche und Wissensbündelung zu Theorien, Erkenntnissen und Evaluationen auf dem Gebiet des Audience Developments, Fragen rund um Kulturelle Teilhabe und Partizipation sowie damit einhergehend den Abbau von Diskriminierungsstrukturen in der Kulturszene.
Auf dieser Basis konzipieren wir Workshops, um Publikum kennenzulernen und eine Zielsetzung hinsichtlich des individuellen Diversitätsvorhabens zu definieren. Anschließend zeigen wir Maßnahmen auf, wie der Prozess aussehen könnte. Da dieser keinem Schema F folgen kann, sondern auf die Ressourcen der jeweiligen Akteur:innen zugeschnitten werden muss, speisen sich diese Vorschläge aus Forschung und Annahmen, Good Practice-Beispielen sowie unseren Erfahrungen und Erkenntnissen aus Köln.
Zudem schaffen wir eigene Weiterbildungsmöglichkeiten, z. B. mit Vorträgen zu diskriminierungssensibler Sprache, Praxisberichten und DIY-Workshops. Dabei kooperieren wir mit Expert:innen und knüpfen Netzwerke.
In welchen Kulturinstitutionen konntet ihr bisher wirken – und welche Veränderungen oder Aha-Momente habt ihr dabei beobachtet?
Anna Döbbelin:
Wir haben von der Publikumsbefragung eines kleinen freien Ensembles über einen Zukunftsworkshop mit einer ganzen Interessenvertretung bis hin zur Beratung der LVR-Kulturkonferenz 2024 schon quer durch die Szene mitgearbeitet und gelernt. Eine Erkenntnis, die wir öfter haben, ist, dass in Sachen Ausschluss und Barrieren entweder noch wenig Wissen vorhanden ist, Ratlosigkeit herrscht, wie ein Veränderungsprozess begonnen wird, oder es sogar rückschrittige Entwicklung hin zu mehr Konservatismus gibt. Unser Ansatz, für diskriminierende Strukturen im Kulturbereich zu sensibilisieren und eine Selbstreflexion anzuregen, erscheint daher immer wieder sinnvoll.
Jérôme Jussef Lenzen:
Unsere Zielsetzung ist langfristig angelegt. Wichtig ist uns daher insbesondere, dass wir nachhaltige Veränderungen anstoßen, die Szene bei ihren ersten Schritten begleiten und ermutigen. Ein besonderer Aha-Moment ist mir aus einem Workshop in Erinnerung geblieben, den wir „Zukunfts-Publikums-Werkstatt“ nennen. Dabei analysieren wir anhand von gesellschaftlichen Megatrends die Herausforderungen, mit denen Kultureinrichtung aller Voraussicht nach in zehn Jahren zu tun haben werden. Das klingt auf den ersten Blick schwer greifbar, aber im Prozess hat es bei dem einen oder anderen plötzlich hörbar Klick gemacht. Auf einmal hat die Frage nach Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit einen Orchestermanager dazu bewogen, über Rezeptionsformen, Probenformate und weiteres zu reflektieren.
Wie gelingt es euch, Menschen anzusprechen, die sich selbst vielleicht (noch) nicht als Teil des „klassischen Publikums“ verstehen?
Jérôme Jussef Lenzen:
Unser Hauptzielgruppe sind in erster Linie die Kulturinstitutionen. Wir verfolgen da eine sehr stark von Carmen Mörsch [1; 2] geprägte Perspektive: Nicht die Gesellschaft oder das Publikum muss an die Kultur herangeführt werden, sondern vice versa sind es die selbstreferenziellen Kultureinrichtungen, die wieder an die Gesellschaft herangeführt werden müssen. Dazu ist es wichtig, die eigene Position zu reflektieren und das eigene Team so zusammenzustellen, dass es viel von „dieser Gesellschaft“ versteht und nicht selbst ein Abziehbild des „klassischen Publikums“ darstellt.
Was wünscht ihr euch von der aktuellen Kulturpolitik oder Förderpraxis, um langfristig eine diversere Publikumslandschaft zu ermöglichen?
Anna Döbbelin:
Köln hat die besten Voraussetzungen für ein diverses Publikum, denn die Kulturlandschaft ist es ganz von selbst. Wir verfügen über eine große freie Szene, die alles mitbringt, um ganz unterschiedliche Publika zu erreichen. Das Referat für Kulturelle Teilhabe im Kulturamt der Stadt, von dem auch das Studio Audience finanziert wird, fördert insbesondere die Projekte, die Diversität und Teilhabe forcieren und unterstützt die Szene bei der Inklusion.
Jérôme Jussef Lenzen:
Dennoch wünschen wir uns, dass das Erreichen eines diversen Publikums stärker als (hartes) Kriterium bei der Bewertung von Projekten in Jurysitzungen aufgenommen wird, damit mehr diversitätsfördernde Projekte umgesetzt werden. Aktuell ist es noch so, dass sehr stark auf die reine Besuchenden-Statistik geschaut wird. Dadurch entsteht eine enorme Verzerrung, weil Mehrfachbesuchende die Gesamtzahl der an klassischen Kunst- und Kulturangeboten partizipierenden Bevölkerung künstlich erhöht. Hier brauchen wir eine klare kulturpolitische Erwartungshaltung: Mehr Teilhabe, oder wir fördern andere Vorhaben, die das konsequenter hinbekommen.
Literaturverzeichnis
[1] Mörsch, Carmen (2025/2024). Diskriminierungskritische Perspektiven an der Schnittstelle von Bildung und Kunst. Einblicke in konzeptuelle Rahmungen, Methodik und Bildungsverständnis eines digitalen Lehr-Lernmaterials. In: KULTURELLE BILDUNG ONLINE. Abgerufen von https://www.kubi-online.de/artikel/diskriminierungskritische-perspektiven-schnittstelle-bildung-kunst (Stand: 10.06.2025).
[2] Mörsch, Carmen (2009). Am Kreuzungspunkt von vier Diskursen: Die documenta 12 Vermittlung zwischen Affirmation, Reproduktion, Dekonstruktion und Transformation. Abgerufen von https://whtsnxt.net/249 (Stand: 10.06.2025).
Kurzvita der Autor:innen
Anna Döbbelin
Anna Döbbelin (sie/ihr) ist Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin und hat in verschiedenen Museen in Nordrhein-Westfalen Veranstaltungen konzipiert und Kunst vermittelt. Derzeit arbeitet sie im Käthe Kollwitz Museum Köln und doziert beim Kölner Institut für Kultur und Weiterbildung u. a. zu Audience Development. Seit der Gründung 2023 baut sie zusammen mit ihrem Team das Studio Audience im ArtAsyl e. V. auf.
Jérôme Jussef Lenzen
Jérôme Jussef Lenzen (er/ihn) ist Programmleiter für Kulturpolitik & Kulturmanagement an der Bundesakademie für kulturelle Bildung sowie Gründer und Vorsitzender von ArtAsyl e.V. und Studio Audience. Zudem engagiert er sich kulturpolitisch als sachkundiger Einwohner im Kulturausschuss der Stadt Köln und als Jurymitglied des Diversitätsfonds im Ministerium für Wissenschaft und Kultur.
Bleiben Sie auf dem Laufenden
Newsletter
Mit unserem Newsletter erhalten Sie monatlich Aktuelles rund um das Thema Energie und Nachhaltigkeit.
Wie bewegt Nachhaltigkeit die Kultur in Nordrhein-Westfalen? Folgen Sie uns auf LinkedIn und bringen Sie sich ein.