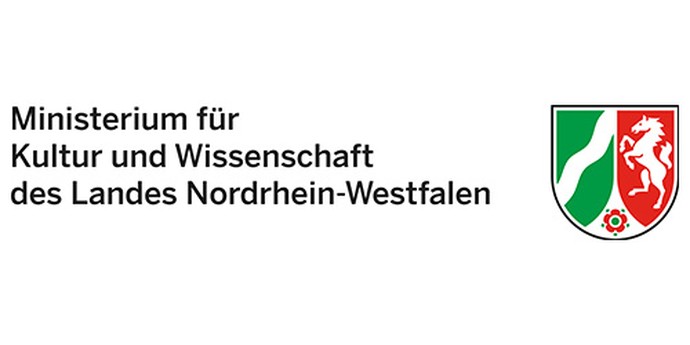Die „Ausputzmaschine“
„Ausputzmaschine“ – so heißt die beeindruckende Maschine, die bis heute das Herz der wenigen Schuhmacherwerkstätten, die es noch gibt, bildet. Im LWL-Freilichtmuseum Hagen zeigen wir ein Exemplar, das die Bad Salzufler Firma HARDO in den 1950er-Jahren auf den Markt brachte. Sie kam 1955/56 in die Werkstatt des Paderborner Schuhmachermeisters Josef Menne. Er übergab seinen Betrieb 1985 an Karl Hilleke, der ihn bis 2015 fortführte und an der Maschine arbeitete. Die Werkstattausstattung kam 2016 ins Museum, in kurzen Filmen erzählt der Schuhmachermeister aus seinem Berufsleben und erklärt auch die Maschine.
Sie steht für etwas, das seit über 125 Jahren das Kerngeschäft des Schuhmacherhandwerks ist. Nachdem seit Ende des 19. Jahrhunderts Schuhe überwiegend in industriellen Betrieben hergestellt wurden, entwickelte sich das traditionsreiche Handwerk vom Produktions- zum Reparaturhandwerk. Was früher aus Sparsamkeit und aufgrund beschränkter finanzieller Mittel selbstverständlich war, ist heute zum Ausdruck von Nachhaltigkeit geworden: Schuhe nicht gleich wegzuwerfen, wenn sich die Sohle gelöst hat oder die Absätze abgelaufen sind, sondern sie fachgerecht reparieren zu lassen. Damit hält das Konsumgut Schuh länger und es werden Ressourcen geschont. Hier kommt die Ausputzmaschine zum Einsatz. Mit ihr können die neu aufgesetzten Absätze und Sohlen geschliffen werden.
Die Ausputzmaschine ersetzte zahlreiche Werkzeuge und reduzierte die Zeit zum Bearbeiten von Sohlen und Absätzen eines Paar Schuhe von etwa 70 bis 90 auf rund 15 Minuten. Solche Maschinen gehörten neben Nähmaschinen zu den technischen Hilfsmitteln, die bereits in den 1920er-Jahren in Schuhmacherwerkstätten verbreitet waren. Der Betrieb von Karl Hilleke behauptete sich auf einem schwierigen Markt. 1949 gab es in Paderborn 64 Schuhmacherbetriebe, 2016 waren es nur noch zehn, heute ist es noch einer, der zudem als Orthopädieschuhmacher spezielle Anfertigungen herstellt. Besonders seit den 1970er-Jahren sank die Zahl der Schuhmachereien. Immer weniger Schuhe wurden zur Reparatur gebracht, gleichzeitig entstand mit Schnellreparaturbetrieben eine neue Konkurrenz. Und heute haben viele Schuhe nicht mehr die Qualität und Ausführung, um ausgebessert werden zu können.
Das Uhrmacherhandwerk
Was für Schuhe gilt, trifft auch für viele weitere Produkte zu. Sie lassen sich kaum noch reparieren oder die Reparaturkosten erscheinen gegenüber der Neuanschaffung unverhältnismäßig hoch. Dabei haben viele Jahrzehnte handwerkliche Berufe wie die Schuhmacher in der Ausbesserung industriell hergestellter Massenwaren ein wichtiges Tätigkeitsfeld gefunden. Dazu zählt beispielsweise das Uhrmacherhandwerk, in dem in der Regel bereits seit über 150 Jahren nur noch anlässlich von Prüfungen Uhren angefertigt werden. Es hat sich hauptsächlich darauf verlegt, defekte Uhren wieder zum Laufen zu bringen und andere Serviceleistungen anzubieten. Eine entsprechende Werkstatt ist im Freilichtmuseum zu sehen, ein Uhrmacher erläutert dort seine vielfältigen Tätigkeiten.
Altem neues Leben geben
Ausstellung zu Reparatur und Nachhaltigkeit im LWL-Freilichtmuseum Hagen
Reparieren und die damit in der Regel verbundene Nachhaltigkeit spielen auch aktuell in Handwerksberufen eine wichtige Rolle. Konkret nachvollziehbar wird dies zur Zeit in einer Ausstellung im LWL-Freilichtmuseum Hagen. Für die gemeinsam mit dem LWL-Medienzentrum entwickelte Präsentation „Mission Machen. Neue Perspektiven auf das westfälische Handwerk“ hat die Fotografin Tuula Kainulainen in den vergangenen Jahren 25 Betriebe fotografisch dokumentiert und mit den Handwerkerinnen und Handwerkern Gespräche geführt.
Sie fragte dabei nach der Bedeutung von Nachhaltigkeit, die inzwischen selbstverständlich generell wichtig ist, etwa bei der Materialbeschaffung, dem Einsatz von Chemikalien und der Abfallentsorgung. In einer eigenen Abteilung unter dem Titel „Geachtet. Geschätzt. Bewahrt“ werden aber ganz konzentriert Handwerke vorgestellt, bei denen das Reparieren, Restaurieren und Konservieren zentrale Arbeitsaufgaben bilden – sie sind gleichsam Werkstätten des Erhaltens. Dazu zählen u. a. eine Geigenbauwerkstatt, ein Karosseriebaubetrieb, eine Kunstschmiede und eine Polsterei.
In der Polsterei „take a seat“ in Ibbenbüren verhilft der Raumausstattermeister und Polsterer Dennis Mönnekemeyer seit über 25 Jahren alten Möbeln zu einem zweiten Leben. Damit trägt er dazu bei, dass weniger Einrichtungsobjekte entsorgt werden. Zu seiner Arbeit gehören Materialverständnis und gestalterisches Know-how, aber auch Industrienähmaschinen und die Heftpistole. Seinen Internetauftritt nutzt der Handwerker auch, um für die Aufbereitung von Möbelstücken zu werben.
Ein Blick in die Ausstellung „Mission Machen“
Gegenstände aus den vorgestellten Betrieben zum Anfassen machen die Präsentation zu einer besonders sinnlichen Erfahrung.
Die Ausstellung ist noch bis zum 31. Oktober 2025 zu sehen. Bereits jetzt und auch noch nach Ende der Ausstellung ist eine Präsentation dazu unter https://missionmachen.lwl.org/de/ [2] zu finden.
Wenn Reparieren zum Beruf wird
Während sich im Handwerk der Polsterei in den vergangenen 150 Jahren der Schwerpunkt von der Herstellung von gepolsterten Objekten zu deren Aufarbeitung und Reparatur verlagert hat, sind andere Berufe gleich als Dienstleistungshandwerke und damit Reparaturhandwerke entstanden, etwa das Radio- und Fernsehtechnikerhandwerk. Es startete in den 1930er-Jahren mit der Reparatur und dem Verkauf von Radios und erlebte in den 1950er-Jahren einen Aufschwung, als Fernsehgeräte in vielen Haushalten aufgestellt wurden – und bald auch repariert werden mussten. Inzwischen heißt der Beruf „Informationselektroniker:innen, Schwerpunkt Geräte- und Systemtechnik“ und kümmert sich um Unterhaltungselektronik und Medientechnik.
Literaturverzeichnis
[1] LWL-Medienzentrum für Westfalen, LWL-Freilichtmuseum Hagen (Hrsg.) (2025). Mission Machen. Neue Perspektiven auf das westfälische Handwerk. Tecklenborg Verlag GmbH & Co. KG.
[2] Landschaftsverband Westfalen-Lippe (o. J.). Mission Machen. Neue Perspektive auf das westfälische Handwerk. Abgerufen von LWL | Startseite - Mission Machen (Stand 18.08.2025).
Kurzvita der Autorin
Dr. Anke Hufschmidt
Dr. Anke Hufschmidt studierte Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Mittlere Geschichte sowie Volkskunde an den Universitäten Freiburg und Hamburg. Nach beruflichen Stationen am Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, am Institut für Lippische Landeskunde, bei der Museumsinitiative in Ostwestfalen-Lippe sowie am Stadtmuseum Düsseldorf ist sie seit 2006 stellvertretende Museumsleiterin und Leiterin des Wissenschaftlichen Dienstes im LWL-Freilichtmuseum Hagen.
Bleiben Sie auf dem Laufenden
Newsletter
Mit unserem Newsletter erhalten Sie monatlich Aktuelles rund um das Thema Energie und Nachhaltigkeit.
Wie bewegt Nachhaltigkeit die Kultur in Nordrhein-Westfalen? Folgen Sie uns auf LinkedIn und bringen Sie sich ein.